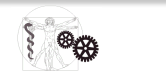Akademie Medizinische Informatik, Heidelberg (Leiter: Prof. Dr. Claus O. Köhler)
Multimediales Patienteninformierungssystem -
der erste Schritt auf dem Weg zu CAPS (Computer Aided Patient Support)
Hägele M., Sljivljak N., Köhler C.O.
Patienten müssen immer noch mit minimalen oder oft genug überhaupt keinem Wissen ständig Entscheidungen treffen, die für sie z.T. lebensentscheidend sind [KÖHLER]. Zwei Drittel der Menschen in einem Wartezimmer des Gesundheitswesens säßen dort nicht, wenn sie auch nur ein kleines bißchen Wissen von der Medizin und ihrem Körper hätten. Eine Seite der Medaille. Die andere: zwei Drittel der Patienten, die dringend zum Arzt müßten, gehen viel zu spät dorthin, leiden mehr als nötig und verursachen viel mehr Kosten als nötig. Dieses Mißverhältnis gilt es im Sinne der Patienten und der Reduzierung der Gesundheitskosten zu verbessern.
Eine Studie am Boston University Medical Center untersuchte 815 Patienten und stellte fest, daß 36 Prozent der Patienten iatrogene Symptome aufwiesen. Symptome also, die nicht aufgetreten wären, wenn keine medizinische Behandlung erfolgt wäre. 9 Prozent der Fälle waren lebensbedrohend oder verursachten bleibende Behinderungen [STEEL].
Dr. Franz Ingelfinger Herausgeber des „New England Journal of Medicine“ schrieb: „Gehen wir davon aus, daß achtzig Prozent der Patienten an Krankheiten leiden, die entweder selbstlimitierend oder auch von der modernen Medizin nicht zu verbessern sind.... In knapp über zehn Prozent aller Fälle zeigt ein medizinisches Eingreifen deutlichen Erfolg.... Leider ist es bei den verbleibenden neun Prozent, plus oder minus einige Zehntel, so, daß der Arzt unangemessen diagnostiziert oder behandelt, oder er hat einfach Pech. Was immer der Grund auch sein mag, der Patient bekommt iatrogene Probleme“ [INGELFINGER]. Diese Feststellung stammt aus dem Jahre 1977. Angenommen, durch den medizinischen Fortschritt hätten sich die selbstlimitierenden Krankheiten noch einmal um 10 Prozent verringert (was in dieser Höhe sicher unangemessen ist), dann sind immer noch 70 Prozent der Krankheiten selbstlimitierend, d.h. der Arzt kann höchstens unterstützend behandeln und der Patient muß mit dieser Krankheit zurecht kommen bzw. muß das Beste daraus machen.
Andererseits muß natürlich alles unternommen werden, daß die iatrogenen Symptome auf ein Mindestmaß gedrückt werden. Dabei ist zum einen sicher die Medizin und auch die Medizinerausbildung gefragt. Zum anderen kann aber auch noch viel Potential erschlossen werden, wenn der Patient in die Diagnostik und Therapie miteinbezogen wird, sie versteht und unterstützt. Non-compliance-Problemen könnte somit vorgebeugt werden.
Die Nichteinhaltung von ärztlichen Verordnungen beruht meist nur darauf, daß die vielen Informationen, die dem Patienten während einer Sprechstunde vermittelt werden, falsch verstanden oder vergessen werden. Trotzdem wird von ihm gesetzlich verlangt, daß er sich für eine Therapie in Form einer Einverständiserklärung entscheidet. Dies tut er, obwohl wie Untersuchungen ergaben, 54% aller Patienten nicht alles verstanden, was sie unterschrieben [BYRNE].
27% der Patienten einer anderen Studie wußten nicht einmal, welches Organ bei Ihnen operiert wurde. 44% konnten das Prinzip des chirurgischen Eingriffs nicht nachvollziehen [SAW]. Das führt dazu, daß der Patient seine Verantwortung abgibt und die Behandlungsprozedur nur über sich ergehen läßt. Hier wird aber ein riesiges Potential verschenkt. Denn aktive, informierte und aufgeklärte Patienten werden schneller wieder gesund und können auch besser mit Ihrer Gesundheit/Krankheit leben. Ein solcher Patient könnte dann auch erfolgversprechend in die Qualitätssicherung miteinbezogen werden.
Ein weiterer Punkt, der die Patienten-Informierung so wichtig macht, ist eine starke Zunahme der sogenannten OTC-Produkte: Medikamente und Präparate also die direkt „over-the-counter“ verkauft werden ohne rezeptpflichtig zu sein. Dabei würde oft ein Verständnis des Krankheitsbildes dafür sorgen, daß weniger Medikamente eingenommen werden bzw. besser Vorsorge getroffen wird. So dauert ein Schnupfen halt eine Woche egal wie viele Medikamente man zu sich nimmt. Laut einer Studie in England behandelt jeder vierte seine Leiden selbst mit OTC-Produkten. Bei Kopfschmerzen sind es gar 80 Prozent der Patienten, die sich so selbst behandeln, während es bei Husten immerhin noch 56 Prozent sind. 13 Prozent der Befragten mit kleinem Leiden, nahmen Medikamente ein, die sie schon einmal verschrieben bekamen [HUW].
Diese Medikamente tauchen aber in keiner Dokumentation auf. Auch in der „normalen“ Sprechstunde werden diese Präparate oft nicht erwähnt, sei es nun weil sie schon so selbstverständlich sind, oder weil man es in dieser kurzen Gesprächszeit einfach vergißt. Wechselwirkungen können also eventuell unentdeckt bleiben. Die Apo-Card widmet sich dieses Problemkreises, kann aber auch nicht die „Altmedikamenteneinnahme“ erfassen. Hier würde nur eine selbstgeführte Patientendokumentation weiterhelfen. Diese wiederum kann nur geführt werden, wenn der Patient entsprechend informiert ist und weiß was und wie er es zu dokumentieren hat. Auch muß er entsprechend unterstützt und z.B. mit Hilfe von Assistenten geführt werden, um diese Dokumentation professionell zu meistern. Des weiteren muß natürlich ein Medium für diesen Informationsfluß definiert werden. Hier würde sich z.B. ein häuslicher PC in Verbindung mit einer Smartcard anbieten [ELLSÄSSER94].
Die Rede ist immer wieder vom mitarbeitenden, aufgeklärten Patienten. Dieser mag auf den ersten Blick utopisch erscheinen und es wird ihn sicherlich nicht von heute auf morgen geben. Um dieses Ziel zu erreichen bedarf es Systeme, die den Patienten bei dieser neuen, zugegebenermaßen schwierigen Aufgabe unterstützen. Auf sich allein gestellt kann er diese organisatorischen Aufgaben und das Wissen, das dazu erforderlich ist, nicht bewältigen.
Doch bevor er versteht und aktiv werden kann, bedarf es erst einmal der Information. Patienteninformierung ist ja nichts Neues. Sie wird seit Anbeginn der Medizin angewendet, ist aber durch die moderne Medizin und die „technische“ Diagnostik etwas ins Hintertreffen geraten. Auch wurde dem Patienten das Interesse daran abgesprochen. Lieblos und textlastig gestaltete Informationsbroschüren in einer laienunverständlichen, medizinischen Fachsprache, taten ein übriges. Die Hemmschwelle sich mit einer so komplexen Thematik zu beschäftigen wie der Medizin ist ziemlich groß und muß dadurch gesenkt werden, daß Informationen patientenorientiert, leicht verdaulich, interessant und sehr anschaulich aufbereitet werden. Dies war mit herkömmlichen Methoden nur sehr schwer in den Griff zu bekommen. Filme und Videos sind zu linear und behäbig in der Anwendung, Farbbroschüren teuer und schwierig in der Darstellung von zeitlichen Verläufen. Multimedia, als die interaktive Verknüpfung von verschiedenen Medien wie Text, Bild, Ton, Animation und Video, bietet hier neue Möglichkeiten.
Ziele der Patienteninformierung
Emanzipation des Patienten
Diese Informierung ermöglicht, daß Patienten gleichwertige Gesprächspartner werden können, da sie dann im Stande sind, den Ausführungen ihres Arztes oder Therapeuten zu folgen und sein Vokabular zu verstehen; Mißverständnissen wird vorgebeugt und der Patient kann "echte" Entscheidungen treffen, da er dann versteht worüber er entscheidet. Er kann durch seine Informiertheit besser mit Gesundheit/Krankheit zurecht kommen. Er fühlt sich besser verstanden und kann gleichwertiger Partner sein. Insgesamt bietet die Informierung die notwendige Basis für echte Kommunikation, d.h. der Patient kann seine Probleme besser und gezielter dem Arzt mitteilen.
Der Patient soll in den Behandlungsprozeß integriert werden können
Dadurch, daß der Patient genau weiß, was mit ihm geschieht, wie die Behandlung aussieht und worauf es ankommt, kann er besser in den Behandlungsprozeß integriert werden und mitarbeiten, d.h. er kann mitdokumentieren, mitkontrollieren und auch mitentscheiden. Denn erst durch die umfassende Informierung kann er relevante Informationen, Therapienebeneffekte oder Komplikationen frühzeitig erkennen und den Arzt darauf aufmerksam machen. Somit bietet sich die Chance Fehlern vorzubeugen, wie ein Artikel und Erfahrungsbericht von N. M. Davis mit dem Titel "Teaching patients to prevent errors" zeigt [DAVIS].
Der Patient soll schneller gesund werden können
Untersuchungen haben ergeben, daß aufgeklärte, aktive Patienten schneller wieder gesund werden [BRODY, GREENFIELD, MAHLER] bzw. besser mit ihrer Gesundheit/ Krankheit leben können. Durch die verbesserte Informiertheit der Patienten ist also auch ein schnellerer Heilungsprozeß und damit auch die Einsparung von Kosten zu erwarten.
Prävention
Durch die frühzeitige, umfassende Informierung und den Umgang mit einem System, mit dem Gesundheit interessant, informativ und spannend dargestellt wird, könnte auch präventiv viel mehr erreicht werden
Diese Ziele legen den Grundstein für eine völlig andere Betrachtungsweise des Gesundheitssystems: nämlich ein Patientenzentriertes. Sie bieten darüber hinaus aber noch ganz andere Chancen. Durch die Informiertheit des Patienten kann dieser Aufgaben übernehmen und den Arzt aktiv unterstützen, ja ihm sogar Arbeit abnehmen z.B. bei der Dokumentation. Es entsteht eine echte Partnerschaft, von der beide profitieren. Der Patient bekommt eine individuellere Behandlung ist wieder Individuum und kann seine Ängste, Bedenken und Wünsche so formulieren, daß sie der Arzt wahrnimmt und versteht. Dem Arzt wird Routinearbeit abgenommen (Anamnese, Teile der Verlaufsdokumentation) und er kann sich mehr den individuellen Problemen des Patienten widmen.
Die neuen Aufgaben und Anforderungen, die an diesen „neuen“ Patienten gestellt werden [ELLSÄSSER93] sind allerdings ohne Unterstützung nicht zu lösen. Der Patient braucht also Systeme, die ihn in seiner neuen Rolle unterstützen: Computer-Aided-Patient-Support oder kurz CAPS genannt.
Ziele von CAPS-Systemen
Unterstützung des Patienten in den Bereichen:
Information,
Dokumentation,
Organisation,
Kommunikation und
Qualitätssicherung.
Ein Szenario mit CAPS-Unterstützung könnte z.B. in 10 Jahren so aussehen: Herr Müller hat seit einigen Tagen heftige Beschwerden in seinen Gelenken und will, da es nicht besser wird einen Arzt konsultieren. Er setzt sich an seinen PC und startet das CAPS-Organisationsmodul. Er grenzt seine Beschwerden ein und bekommt die Empfehlung zum Allgemeinarzt zu gehen. Er gibt einen für ihn wünschenswerten Termin ein. Das Organisationsmodul befragt mit Hilfe des CAPS-Kommunikationsmoduls die örtliche Datenbank und listet Allgemeinärzte wahlweise nach Entfernung oder nach Qualitätsmerkmalen (dazu später mehr) geordnet auf. Ein Doppelklick genügt, um das CAPS-Kommunikationsmodul anzuweisen Verbindung mit dem Organisationsmodul des Arztes aufzunehmen und einen Termin zu vereinbaren.
Herr Müller schiebt seine Patientenkarte - eine Smartcard - ein und überprüft die Daten auf der Karte. Die Tripperbehandlung macht er für den Arztbesuch unsichtbar, das geht seiner Meinung nach den Allgemeinarzt in diesem Zusammenhang nichts an.
Anschließend gibt Herr Müller Assistentengesteuert Daten zum anstehenden Arztbesuch ein.
In der Arztpraxis schaut sich der Arzt die Anamnesedaten und die Informationen, die zum aktuellen Arztbesuch führten, an und kann gezielt nachhaken und Eintragungen hinterfragen. Nach Beendigung des diagnostischen Prozesses schreibt er seine Diagnose elektronisch auf die Karte.
Herr Müller kann mit seiner Karte nun über das CAPS-Informationsmodul Informationen zu seiner Diagnose abrufen. Das Krankheitsbild, die Prognose und mögliche Therapiemöglichkeiten werden erläutert. Dies Informierung kann zu Hause oder direkt in der Praxis erfolgen. Das weitere Vorgehen spricht Herr Müller dann mit seinem Arzt ab. Die Unterhaltung läuft jetzt sehr viel „professioneller“, informationsreicher und zielgerichteter ab, da der Patient Müller nun auch mitreden und nachfragen kann.
Die Behandlungsdaten wie Medikamentenverordnungen, weitere Termine, Überweisungen werden auf der Karte abgespeichert. Bei nicht zeitkritischen Unklarheiten kann sich Herr Müller von zu Hause aus mit Hilfe des Kommunikationsmoduls per E-Mail an den Arzt wenden. Das ermöglicht dem Arzt ungestörtes Arbeiten, da er dann zu einem für ihn günstigen Zeitpunkt diese Fragen in Ruhe abarbeiten kann.
Nach Abschluß der Behandlung kann Herr Müller mit dem CAPS-Qualitätssicherungsmodul einen Fragebogen zur Zufriedenheit mit den Leistungen des Arztes auf seinem PC ausfüllen. Die Daten werden dann anonymisiert an den Arzt und an die örtliche Datenbank übermittelt. So kann der Arzt die Patientenzufriedenheit in seine Planungen miteinbeziehen. Die örtliche Datenbank erhält zu dieser Patientenrückinformationen von einem örtlichen Qualitätssicherungszirkel auch proffessionelle Qualitätsmerkmalsdaten. Diese Merkmale basieren nicht auf empfundener Qualität wie im Patientenfalle, sondern basieren auf Merkmale wie Behandlungserfolge, Strukturqualität der Praxis usw. Schon allein diese Merkmale zu finden und zu definieren bedarf es noch viel Forschungsarbeit. Diese Informationen werden genutzt, um sie bei Bedarf dem Patienten bei der Arztauswahl anzuzeigen.
Doch zurück zur Gegenwart, in die Wirklichkeit und zum Patienten-Informierungs-System, das eine zentrale Rolle in CAPS (Computer Aided Patient Support) spielt. Es soll den Arzt ergänzen, ihm die Routineaufklärung abnehmen und dem Patienten individuell Begriffe, Therapiemaßnahmen und komplexe Wirkungszusammenhänge visualisieren.
Die hierzu eingesetzte Software, muß leicht zu bedienen sind und es muß dem Patienten Spaß machen, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Hier kann ein multimediales System, mit Sound, Animationen, Video und Grafiken helfen. Gleichzeitig erfolgt die Informationsaufnahme mit einem multimedialen System schneller. Auch bleiben Informationen länger im Gedächtnis, da gleichzeitig mehrere Sinne des Menschen (Ohr, Auge (Standbild und/oder Bewegtbild)) angesprochen werden. Auch sind die Informationen in gleichbleibender Qualität 24 Stunden pro Tag verfügbar.
Als Aufstellungsorte kommen Wartezimmer von Arztpraxen und Therapeuten in Frage, in Krankenhäusern sollte auf jeder Station mindestens ein mobiles Patienteninformierungssystem zur Verfügung stehen, um die Bedürfnisse der Patienten nach Information und die Einbeziehung des Patienten in den Behandlungsprozeß zu ermöglichen. Apotheken, Krankenkassen oder Selbsthilfegruppen wären weitere mögliche Aufstellorte. Hauptziel ist es aber das System auch zu Hause (z.B. per CD-ROM) verfügbar zu machen, da man hier die nötige Ruhe und Zeit hat sich zu informieren.
Eine Entwicklungsumgebung für Informierungs-System wurde entwickelt, die visuell und ohne Programmierkenntnisse mit Leben, sprich multimedialen Daten, gefüllt werden kann. Dieses Autorensystem gibt dabei schon eine Struktur vor, die in einer wissenschaftlichen Arbeit erarbeitet wurde und die Strukturierungs- und Steuerungsmaßnahmen für Patienten-Informierungs-Systeme vorgibt [HÄGELE]. Bei einer Demo-Implentierung am Beispiel der Orthopädie wurde auch viel Wert auf die Visualisierung von Operationen und Wirkungszusammenhängen gelegt, da gerade bei diesen die Erklärungsmöglichkeiten in Form von Sprache, Text, Standbildern oder Video beschränkt sind.
Computeranimationen, die auf jedem windowsfähigen Rechner lauffähig sind und somit für eine breite Bevölkerungsschicht erschwinglich werden, bieten hierbei große Vorteile gegenüber Video. Videos sind für die Patientenaufklärung in Sachen Therapiemöglichkeiten oft ungünstig, da sie entweder sehr blutig sind oder das Wesentliche der Operation sehr schwierig erkennen lassen. Im Zeichentrick oder in echter 3D-Darstellung können hier selbst wenig ansehnliche, weil sehr blutige, Operationen wie z.B. die Totalendoprothese dem Patienten auf eine ästhetische Art veranschaulicht werden. Durch seine interaktive Multimedialität visualisiert das Patienten-Informierungs-System auch komplexe Operationen einfach und leicht verständlich ohne dabei schwieriges medizinisches Vokabular benutzen zu müssen. Dem Patienten bietet sich damit erstmals ein Modell, das er als Gesprächsgrundlage benutzen kann, um dem behandelnden Arzt Fragen zu stellen. Erfolgsaussichten, Komplikationen und Risiken von Operationen werden ebenfalls aufgeführt. Krankheitsbilder sind auch anhand von Röntgen-, CT oder Ultraschall-Aufnahmen erläutert. Erfahrungen haben gezeigt, daß Texte und Informationen von Klinik zu Klinik, von Praxis zu Praxis und von Arzt zu Arzt gerne anders formuliert oder Angaben hinzugefügt oder weggelassen werden wollen. Diesem Aspekt wurde ebenfalls Rechnung getragen, indem das Autorensystem so konstruiert wurde, daß solche individuellen Änderungen problemlos möglich sind.
Ebenso einfach können in dieser Informierungs-System-Entwicklungsumgebung organisatorische Informationen zur jeweiligen Institution, ihren Leistungen und den dort arbeitenden Personen integriert werden. Auch Strukturinformationen wie Übersichtspläne oder Essenspläne können hier leicht und zeitaktuell mit abgelegt werden. Der allgemeine Leistungsumfang kann also mit eigenen Daten und Erkenntnissen, der Institution, wo das System steht, individuell angepaßt werden.
Die Informationen sind in Form einer Datenbank organisiert und sind somit leicht erweiter- und aktualisierbar. Denn ein Informierungs-System, das auf alten Daten basiert, wird schnell an Akzeptanz verlieren. Der Datenbankinhalt wird von einem Programm interpretiert und dargestellt. Bis jetzt ist ein Windows-Version, auf Basis einer Microsoft-Acess™-Datenbank fertiggestellt. Eine WorldWideWeb-Version ist geplant.
Die Bedienung erfolgt vorzugsweise per Touchscreen. Untersuchungen ergaben, daß Maus oder Tastatur einerseits eine erhöhte Hemmschwelle darstellten, sich überhaupt mit dem System zu beschäftigen. Andererseits hatten vor allem ältere Leute haptische Schwierigkeiten mit einer Maus umzugehen. Diese Probleme traten bei der Bedienung per Touchscreen nicht auf.
Wie die Ausführungen gezeigt haben, bringt ein Patienten-Informierungs-System allen Vorteile. Dem Arzt wird Routineaufklärungsarbeit abgenommen, er kann sich wieder stärker der individuellen Situation des Patienten zuwenden. Auch wird ihm ein gutes Stück an juristischen Problemen abgenommen (Stichwort: informed consent), da der Patient wissentliche Entscheidungen treffen kann. Der Patient wird dadurch nicht einfacher zu behandeln werden, aber erfolgreicher. In diesem Zusammenhang teilte Dr. Wawersick in einer persönlichen Mitteilung mit: „Wenn ich mit einem Patienten intensiv alles durchspreche und wirklich auf ihn eingehe brauche ich am nächsten Tag nur die Hälfte des Anästhetikums“.
Dem Patienten ermöglicht es eine aktivere Rolle im Gesundheitswesen einzunehmen. Er versteht sein Leiden besser und kann entsprechend besser mit ihm umgehen und zurechtkommen. Auch kann er Zusammenhänge besser nachvollziehen und seine Medikamenteneinnahme aus eigenem Interesse und damit richtiger tätigen. Insgesamt bietet die computerunterstützte Patienteninformierung Chancen für die Emanzipation des Patienten und ein patientenzentriertes Gesundheitswesen. Es schafft auch die Grundlage für weitere Funktionen, die der Patient z.B. in der Dokumentation und der Qualitätssicherung übernehmen kann.
Das Gesundheitswesen insgesamt würde durch Kosteneinsparungen vor allem bei chronisch Kranken und einem bewußteren Umgang mit dem eigenen Körper profitieren, wenn es zusätzlich die Gesundheitserziehung generell schon frühzeitig in der Schule forciert.
[BRODY] Brody DS, Miller SM, Lerman CE, Smith DG, Caputo GD. Patient perception of involvement in medical care: relationship to illness attitudes and outcomes. Journal Gen Intern Med 1989; 4;506-511
[BYRNE] Byrne D.J., Napier A., Cuschieri A.: How informed is signed consent. BMJ 1988;296:839-40
[DAVIS] Davis N.M.; Teaching patients to prevent errors. Am-J-Nurs; 5;1994:17.
[ELLSÄSSER93] Ellsässer KH, Köhler CO; Shared Care: Konzept einer verteilten Pflege - Kurz- und langfristige Perspektiven in Europa. Informatik, Biometrie und Epidemiologie in Medizin und Biologie 24 No.4 (1993) 188-198
[ELLSÄSSER94] Ellsässer KH, Köhler CO; Smart Card als Patientenkarte. In: Köhler, C.O. (ed.): Medizinische Dokumentation und Information - Handbuch für Klinik und Praxis, Landsberg: ecomed, 1994, III - 17.1 / 1-35
[GREENFIELD] Greenfield S, Kaplan S, Ware J.E. Jr.; Expanding patient involvement in care: effects on patient outcomes. Ann Intern Med 1985; 102:520-528
[HÄGELE] Hägele M., Sljivljak N., Köhler C.O. ; Patienteninformationssystem für den Patienten. In: Kunath H., Straube R., Lochmann U.; Köhler C.O. (ed.): Medizin und Information - Neue Paradigmen in Medizinischer Informatik, Biometrie und Epidemiologie, München: MVV, 1995.
[HUW] Huw D, Thomas V, Noyce PR; The interface between self medication and the NHS. BMJ; 1996:312;688-691
[INGELFINGER] Ingelfinger FJ; Health: a matter of statisics or feeling [editorial]? N-Engl-J-Med. 1977;296(8):448-449
[KÖHLER] Köhler, CO;Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten einer multifunktionalen Patientenkarte, Card-Forum, im Druck
[MAHLER] Mahler H. L., Kulik JA. Preferences for health care involvement, perceived control and surgical recovery: a prospective study. Soc Sci Med 1990; 31:743-51
[SAW] Saw K.C.; Wood A.M.; Murphy K.; Parry J.R.; Hartfall W.G.: Informed consent: an evaluation of patients' understanding and opinion (with respect to the operation of transurethral resection of prostate). J-R-Soc-Med 1994; 87:143-4
[STEEL] Steel K, Gertman PM, Crescenzi C, Anderson J; Iatrogenic illness on a general medical service at a university hospital. N-Engl-J-Med. 1981;304(11):638-42
|